Profitmaximierung und die Alternativen
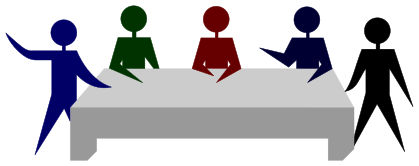 (Voriger Artikel: Märkte für reale, aber nicht für „fiktive“ Waren wie Arbeitskraft und Land?)
(Voriger Artikel: Märkte für reale, aber nicht für „fiktive“ Waren wie Arbeitskraft und Land?)
Im vorigen Artikel hatte ich festgestellt, dass die Alternative zu einem Markt für Arbeitskraft (wo Menschen ihre Arbeitskraft an Firmeneigentümer verkaufen, die sie dann nach eigenem Gutdünken einsetzen) demokratische Kooperativbetriebe sind, deren Mitarbeiter alle sie betreffenden Entscheidungen gleichberechtigt treffen. Nach innen unterscheiden sich solche Kooperativbetriebe (kurz: Kobetriebe) radikal von kapitalistischen Firmen, da es keine Trennung zwischen weisungsbefugtem Management und weisungsgebundenen Angestellten gibt. Nach außen ändert sich hingegen nicht zwangsläufig allzu viel: Kobetriebe stehen womöglich in Konkurrenz zu anderen Betrieben; sie können, wenn sie wollen, versuchen möglichst viele möglichst billig hergestellte Produkte möglichst teuer zu verkaufen, um so ihre Einnahmen zu maximieren und ihre Ausgaben zu minimieren.
Allerdings zeigt sich hier schon ein auffälliger Unterschied zwischen kapitalistischen und Kooperativbetrieben: Ein kapitalistisches Unternehmen wird immer versuchen, die Löhne seiner Mitarbeiter so weit es sinnvoll möglich ist zu drücken (nicht mehr sinnvoll ist die Lohndrückerei aus kapitalistischer Sicht erst dann, wenn Mitarbeiterinnen massenhaft kündigen und zur besser zahlenden Konkurrenz wechseln oder wenn sie so unzufrieden sind, dass sie sich weniger engagieren und die Produktivität leidet). In einem Kobetrieb dürften hingegen alle nicht anderweitig benötigen Einnahmen früher oder später bei den Mitarbeitern landen, da diese gemeinsam entscheiden, was damit passieren soll (sie könnten sich natürlich auch entscheiden, Mehreinnahmen etwa zu spenden, aber das wäre dann ebenfalls ihre eigene Entscheidung). Sich vorher die eigenen Gehälter zu kürzen, um sich die so angesparte Differenz anschließend in Form höher Bonuszahlungen auszuzahlen, macht aber keinen Sinn – die Mitarbeitenden würde sich mit der linken Hand wegnehmen, was sie sich mit der rechten zurückgeben.
Was ist Profit?
Auch wenn Kobetriebe Einnahmen maximieren und Ausgaben minimieren, kann man somit nicht ohne Weiteres sagen, dass sie sich dabei identisch zu kapitalistischen Betrieben verhalten, die ihre Profite maximieren wollen. Macht es Sinn, auch bei Kobetrieben von „Profitmaximierung“ zu sprechen? Um das entscheiden zu können, muss zunächst der Profitbegriff geklärt werden: Was genau zählt zum Profit und was nicht? Sind – zum Beispiel – Bonuszahlungen an die Mitarbeiterinnen Teil des Profits oder Abzug davon? Diese Frage ist nicht so leicht zu klären, wie es zunächst scheinen mag, weil tatsächlich (mindestens) drei unterschiedliche Profitbegriffe im Umlauf sind – die Neoklassik verwendet alleine schon zwei, marxianische Ökonomen noch eine dritte.
Das einfachste Profitkonzept wird „Buchprofit“ (accounting profit) genannt: dieser ist ganz einfach die Differenz zwischen Gesamterlös (total revenue) und Gesamtkosten (total cost) einer Firma (Mankiw 2014, 260, 262). Problematisch an diesem Begriff ist, dass er Eigenkapital und Fremdkapital einer Firma ganz unterschiedlich behandelt – Fremdkapital sind von der Firma aufgenommene Kredite oder von ihr verkaufte Anleihen (eigentlich nur ein anderes Wort für einen kleinen Kredit), für die fest vereinbarte Zinsen gezahlt werden. Diese Zinszahlungen sind Teil der Kosten der Firma – somit zählen sie nicht zum Buchprofit der Firma, sondern mindern diesen entsprechend. Hingegen ist das Eigenkapital das Geld, das die Eigentümerinnen der Firma in diese investiert haben – zur „Belohnung“ für diese Investition dürfen sie entschieden, was die Firma macht und sich (wenn sie wollen) alle erwirtschafteten Profite auszahlen lassen (im Falle einer Aktiengesellschaften sind die Aktien das Eigenkapital und die Ausschüttungen heißen Dividenden). Alle Ausschüttungen an die Eigenkapitalgeber zählen zum Buchprofit, anders als die Zahlungen an Fremdkapitalgeber.
Dass diese analytische Ungleichbehandlung von Eigen- und Fremdkapital unbefriegend ist, sieht die Neoklassik auch und führt deshalb das Konzept der Opportunitätskosten (opportunity costs) ein. Dies sind die (imaginären) Kosten, die einer Eigenkapitalgeberin dadurch entstehen, dass sie ihr Kapital nicht auf andere Weise investiert hat. Mankiw (2014, 261f.) rechnet vor, dass eine Kapitalistin (er nennt sie Caroline) beispielsweise 300.000 Dollar aus ihren eigenen Ersparnissen in ihr Unternehmen einbringt, die sie andernfalls als Festgeld zu vielleicht 5 Prozent Zinsen hätte anlegen können. Ihr entgehen durch ihr Investment also Zinseinnahmen von 15.000 Dollar pro Jahr. Die Neoklassik betrachtet solche imaginären Kosten als Opportunitätskosten, die vom „wirtschaftlichen Profit“ (economic profit) abzuziehen sind. Hat Carolines Firma also 25.000 Dollar Überschuss erwirtschaftet, die sie sich komplett auszahlen lässt, entspricht der Buchprofit diesen 25.000 Dollar, doch der „wirtschaftlichen Profit“ sind nur die 10.000 Dollar, die nach Abzug ihrer Opportunitätskosten übrig bleiben. Reden Neoklassikerinnen einfach von „Profit“, meinen sie in aller Regel diesen „wirtschaftlichen Profit.“
Was verwirrend sein kann, denn wenn Mankiw (2014, 291) etwa zu dem Schluss kommt, dass sich das Preisniveau in einem Konkurrenzmarkt so einpendelt, dass die „am Markt verbleibenden Firmen keinen wirtschaftlichen Profit erzielen können“ [firms that remain in the market must be making zero economic profit], bedeutet das nicht etwa, dass die Eigenkapitalgeber in die Röhre schauen und auf Ausschüttungen komplett verzichten müssen, sondern nur dass die an sie geflossenen Ausschüttungen dem Zinsniveau entsprechen, dass sie auch anderswo hätten verdienen können.
Dem Marx’schen Verständnis (oder dem gesunden Menschenverstand) entsprechend, würde man eher sagen, dass die Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Märkten dazu führt, dass in allen Märkten dieselbe durchschnittliche Profitrate erwirtschaftet wird – aber nicht, dass diese Profitrate, obwohl real positiv, zugleich analytisch „null“ ist (wie es die Neoklassik tut).
Die Neoklassik löst die analytische Ungleichbehandlung von Eigen- und Fremdkapital also dadurch auf, dass die von allen Ausschüttungen an Eigenkapitalgeber deren imaginäre „Opportunitätskosten“ abzieht. Marx geht den umgekehrten Weg: Er betrachtet auch Ausschüttungen an Fremdkapitalgeberinnen als Teil des Profits, auch wenn sie aus der Innenperspektive einer Firma als Kosten (und damit Abzug vom Profit) erscheinen. Er analysiert den Profit als abgeleitete Form des Mehrwerts, wobei alle Zahlungen an Kapitalgeber zum Mehrwert gehören, egal ob es sich um Eigen- oder Fremdkapital handelt. Der in einer Firma produzierte Mehrwert entspricht allerdings in aller Regel nicht genau dem Profit, der an deren Eigen- oder Fremdkapitalgeberinnen fließt, da sich zwischen Firmen aus verschiedenen Branchen eine Durchschnittsprofitrate bildet (wie auch die Neoklassiker wissen). Zudem gehören für Marx auch Mietzahlungen an Grundeigentümerinnen und an den Staat abgeführte Steuern zum Mehrwert, während diese für die Neoklassik Kosten (und damit Abzüge vom Profit) darstellen.
Da das Wort „Profit“ somit in mindestens drei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet werden kann, werde ich im Folgenden die Finger davon lassen und stattdessen entweder von Buchprofit oder von Kapitalerträgen sprechen. Der Buchprofit hat dabei die oben erläuterte Bedeutung: er umfasst, was vom Erlös übrig bleibt, nachdem alle Kosten (einschließlich der Zinszahlungen an Fremdkapital) gezahlt sind. In aller Regel wird ein kapitalistisches Unternehmen diesen Buchprofit zum Großteil an die Eigenkapitalgeber ausschütten, etwa in Form von Dividenden; den Rest kann es in Form von Rücklagen zunächst im Unternehmen belassen. Diese Rücklagen vermehren das Eigenkapital, ohne sofort an dessen Eigentümerinnen ausgezahlt zu werden. Zu beachten ist dabei, dass Neuinvestitionen (die Firma baut ein neues Werk oder schafft neue teure Maschinen an) nicht zum Buchprofit gehören, sondern zu den Kosten – somit werden sie vom Buchprofit abgezogen und reduzieren ihn entsprechend.
Kapitalerträge sind hingegen alle Zahlungen an Kapitalgeberinnen. Neben Dividenden und ähnlichen Zahlungen an Eigenkapitalgeber gehören dazu auch Zinszahlungen an Fremdkapitalgeber – will man zwischen beiden differenzieren, kann man von Eigen- bzw. Fremdkapitalerträgen sprechen. Dies ähnelt eher dem Marx’schen Verständnis von Profit als umverteilten Mehrwert, da hier anders als beim Buchprofit auch Rückflüsse an Fremdkapitalgeberinnen eingerechnet werden – Mietzahlungen und Steuern (anders als bei Marx) allerdings nicht. Auch Rücklagen würde ich nicht zu den Kapitalerträgen rechnen, solange noch nicht entscheiden ist, was mit ihnen passiert – sie können investiert werden (und dann zu den Kosten zählen) oder als Kapitalerträge an die Eigenkapitalgeber ausgezahlt werden.
Profitmaximierung, Lohnmaximierung, Versorgungsorientierung
Nach dieser Klärung des Profitbegriffs können wir nun besser analysieren, was mit „Profitmaximierung“ überhaupt gemeint ist und inwiefern es auch in demokratischen Kooperativbetrieben noch einen Zwang oder Drang in diese Richtung geben würde. Für seine Analyse nimmt Mankiw (2014, 375) ohne weitere Begründung an, dass Firmen profitmaximierend (profit maximizing) sind: Unmittelbar geht es ihnen weder um Qualität oder Quantität der von ihnen produzierten Waren noch um die Lebensqualität ihrer Angestellten, sondern nur darum, möglichst viel Profit zu machen. Gemeint ist dabei der „wirtschaftliche Profit“ der Neoklassik, der gemäß obiger Terminologie proportional zu den Eigenkapitalerträgen ist (von diesen werden allerdings noch die imaginären Opportunitätskosten abgezogen, auf deren Größe das Verhalten der Firma aber keinen Einfluss hat). Fremdkapitalerträge zählen für die Neoklassik hingegen nicht zum Profit, sondern zu den Kosten. Wenn von „Profitmaximierung“ die Rede ist, ist somit die Maximierung von Eigenkapitalerträgen gemeint – keineswegs aber die von Fremdkapitalerträgen.
In der Tat macht es für eine Firma keinen Sinn, ihre Fremdkapitalerträge maximieren zu wollen– andernfalls müsste sie sich darum bemühen, einen der benötigten Produktionsfaktoren (Fremdkapital, d.h. Kredite) möglichst teuer einzukaufen statt möglichst billig. Firmen, die auf Konkurrenzmärkten bestehen wollen, werden sich aber immer darum bemühen, ihre Kosten möglichst gering zu halten – somit werden sie sich auch um die Minimierung, nicht die Maximierung von Fremdkapitalerträgen bemühen, indem sie von den infrage kommenden Krediten tendenziell die zinsgünstigsten nehmen. Ebenso wie um die Minimierung von Fremdkapitalerträgen bemühen sich kapitalistische Unternehmen auch um die Minimierung von Löhnen – sie versuchen, die benötigte Arbeitskraft (einen weiteren Produktionsfaktor) möglichst günstig einkaufen. Je besser die Geschäfte laufen, desto mehr Buchprofit bleibt dem Unternehmen dann, den sich seine Eigentümer als Eigenkapitalerträge auszahlen könnten.
Bei demokratischen Kooperativbetrieben treffen hingegen die Mitarbeiterinnen alle Entscheidungen gemeinsam – solche Betriebe haben somit überhaupt kein Eigenkapital, dessen Eigentümer besondere Ansprüche auf Erträge hätten. Natürlich werden auch Kobetriebe oft Kredite brauchen, um Produktionsmittel und Vorprodukte zu erwerben und den Mitarbeiterinnen Löhne zahlen zu können, bis genügend Einnahmen fließen, um diese Kredite dann wieder zurückzuzahlen. Aber solche Kredite sind Fremdkapital, und genau wie kapitalistische Betriebe werden sich Kobetriebe tendenziell darum bemühen, möglichst günstig an Kredite zu bekommen, d.h. möglichst wenig Zinsen dafür zu zahlen. Eine Maximierung der Kapitalerträge ist für Kobetriebe also gar keine Option – über Eigenkapital, dessen Erträge sie maximieren können, verfügen sie nicht, und die Maximierung von Fremdkapitalerträgen ist für keine am Markt agierende Firma eine sinnvolle Option.
Wenn also Profitmaximierung für Kobetriebe als Firmenziel ausfällt, welche anderen Ziele können sie dann verfolgen? Darauf sind ganz unterschiedliche Antworten denkbar – genau wie im Übrigen auch kapitalistische Unternehmen keineswegs zur Profitmaximierung gezwungen sind, solange sie nicht selbst (als Aktiengesellschaften) auf Kapitalmärkten gehandelt werden. Die zwei nächstliegenden Optionen für Kobetriebe dürften aber Lohnmaximierung und Versorgungsorientierung sein.
Lohnmaximierung ist das direkte Gegenstück zur kapitalistischen Profitmaximierung: Ähnlich wie bei einer kapitalistischen Firma (wo die Eigenkapitalgeber, nicht die Mitarbeiterinnen alle wesentlichen Entscheidungen treffen) die Eigenkapitalgeber oft versuchen werden, möglichst hohe Kapitalerträge zu erwirtschaften, können die Mitarbeiterinnen eines Kooperativbetriebs versuchen, für sich selbst möglichst hohe Löhne zu erwirtschaften. Ob diese Maximallöhne dann in Form regelmäßiger oder gelegentlicher Bonuszahlungen oder in Form besonders hoher Grundgehälter an die Mitarbeiter weitergegeben werden, ist dabei eher ein technisches Detail. Allerdings werden Betriebe wahrscheinlich eher zu Bonuszahlungen tendieren, die je nach wirtschaftlicher Situation größer oder kleiner ausfallen könnten, da im Falle garantierter hoher Grundgehälter schnell die Pleite drohen würde, wenn es wirtschaftlich mal nicht so gut läuft, diese Gehälter aber trotzdem gezahlt werden müssten.
Die Alternative sind versorgungsorientierte Betriebe, deren Hauptziel die Versorgung ihrer Kundinnen mit guten und preisgünstigen Produkten ist. Solche Betriebe zahlen ihren Mitarbeitern feste Löhne, versuchen aber nicht darüber hinausgehende Bonuszahlungen zu erwirtschaften. Läuft es wirtschaftlich gut, bilden sie vielleicht gewisse Rücklagen für schwierigere Zeiten; sind die Einnahmen dann immer noch höher als die Kosten, geben sie den Unterschied in Form von Preissenkungen an die Kundinnen zurück. Darin unterscheiden sie sich von profitmaximierenden sowie lohnmaximierenden Firmen, die nur dann die Preise senken, wenn ihnen die Konkurrenz keine andere Wahl lässt oder sie sich dadurch einen Vorteil im Konkurrenzkampf versprechen (Steigerung des eigenen Marktanteils durch Unterbieten der Konkurrenz). Versorgungsorientierte Kobetriebe (VO-Kobetriebe) senken hingegen immer dann die Preise, wenn ihnen das wirtschaftlich möglich ist, unabhängig davon, ob sie „Konkurrenten“ haben und wie diese sich verhalten. Das eröffnet erweiterte Kooperationsmöglichkeiten für solche Betriebe, die noch zu diskutieren sein werden.
Aber haben VO-Kobetriebe auf dem Markt überhaupt eine Chance? Würden sich die lohnmaximierenden Kobetriebe (LM-Kobetriebe) nicht immer gegen sie durchsetzen? Zunächst ist festzuhalten, dass LM-Kobetriebe zwar tendenziell für die Mitarbeiterinnen attraktiver sind, weil sie ihnen höhere Löhne in Aussicht stellen können. Andererseits punkten VO-Kobetriebe bei den Kunden, weil sie günstigere Produkte anbieten können. Aus dem Kapitalismus ist bekannt, dass der günstigere Anbieter meistens die besseren Karten hat – daraus aber zu folgern, dass die VO-Kobetriebe sich gegenüber den LM-Kobetrieben zwangsläufig durchsetzen werden, wäre sicherlich voreilig. Stattdessen werde ich im nächsten Artikel diskutieren, warum und unter welchem Umständen VO-Kobetriebe tatsächlich die Nase vorn haben.
(Fortsetzung [mit etwas anderer Stoßrichtung als ursprünglich geplant]: Die Genossenschaftsgesellschaft)
Literatur
Mankiw, N. Gregory. 2014. Principles of Economics. 7. Aufl. Stamford, CT: Cengage Learning.
Die Prämisse dass ein Ko-Betrieb ohne Eigenkapital agiert, also hundertprozentig fremdfinanziert, halte ich für fragwürdig.
Vielmehr steht die Entscheidung Rücklage oder Dividende auch hier – im „Laborismus“, wie es verschiedene Autoren nennen – in jedem Moment an. Und Kreditgeber werden sich auch nur einstellen, wenn eine lukrative Beteiligung wirkt. Womit die Perspektive „LM oder VO“ ziemlich relativiert ist.
Es sei denn – aber das kommt hier eben nicht vor – es handelt sich um Kredite, die von außen zuströmen, weil eine Community das Unternehmensziel, sprich die Versorgungsorientierung unterstützt.
„Community Supported Business“ (wie zum Beispiel CSA) ist die einzige Möglichkeit, die ich in unserer kapitalistischen Realität sehe.Recht hast Du insofern, dass es fast naturnotwendig ist, dass die „Mitarbeiter“ über kein einbringbares Kapital verfügen. Das Eigenkapital könnte entstehen durch
* Betriebsbesetzung und Aneignung, also unter ganz spezifischen politischen Umständen
* Zuwendung und Stiftung (eine Rechtsform die eine Re-approprierung unmöglich macht)
* „Ursprüngliche Akkumulation“ durch einen externen Buy-Out, Crowdfunding etc.
Laboristische (Kooperative) Großbetriebe wie Mondragon gibt es; sie sind folgerichtig als Genossenschaften organisiert, weil die „Doppelrolle“ als Mitarbeitender Co-Unternehmer danach verlangt.
Freunde von mir in Österreich führen gerade verschiedene Prozesse zur Entscheidungsübertragung an Mitarbeiter durch und stoßen praktisch an die Notwendigkeit des Eigenkapitals.
Durch Begriffsturnerei wird sich diese nicht weg – eskamotieren lassen.
Sehe ich ähnlich. Es gibt durchaus auch Eigenkapital das ein Unternehmen besitzen kann ohne das es Eigentümer gibt die darauf zugriff oder damit irgend eine Verfügungsgewalt über das Unternehmen hätten.Ein solches Eigenkapital kann für jedes Unternehmen egal welcher Form sinnvoll sein. Meinem Azubi(2.LJ) würde ich jetzt die Aufgabe geben hier eine Liste mit Vorteilen aufzuschreiben.
@Franz (und Eisentor):
Ich glaube, bei dir gehen in einen Betrieb geflossene Gelder (Kapital) und Produktionsmittel — Fabriken, Maschinen, noch nicht verwendete Vorprodukte etc. — durcheinander. Ich hatte im vorigen Artikel schon gesagt, dass für die Neoklassik beides Kapital ist, weil sie die finanzielle Ebene als analytische Realität gar nicht kennt (sondern das Geld für einen bloßen „Schleier“ hält).
Trennt man beides, wird klar, dass ein Betrieb sehr wohl „eigene“ Produktionsmittel haben kann, ohne über Eigenkapital zu verfügen. Beispiel: Dank eines Kredits kauft oder baut ein Betrieb eine Fabrik; sobald der Kredit zurückgezahlt ist, gehört ihm die Fabrik weiterhin, aber Kapital hat er nicht mehr, da der Kredit (Fremdkapital) ja getilgt wurde und Eigenkapital erst gar nicht zum Einsatz kam.
Allerdings hat natürlich auch die Fabrik einen finanziellen Wert, sollte der Betrieb sich zum Verkauf entschließen; und wie erwähnt, kann ein Betrieb auch (finanzielle) Rücklagen bilden. Je nach Definition kann man vorhandene Produktionsmittel sowie Rücklagen sicherlich unter „Eigenkapital“ fassen. Ich würde es aber für sinnvoller halten, hier einen separaten Begriff wie etwa „Betriebsvermögen“ zu verwenden und sich für den Begriff „Eigenkapital“ stattdessen an der Definition des Gabler Wirtschaftslexikons zu orientieren: „jene Mittel, die von den Eigentümern einer Unternehmung zu deren Finanzierung aufgebracht oder als erwirtschafteter Gewinn im Unternehmen belassen wurden.“
Damit ist klar, dass Eigenkapital eben Eigentümer_innen hat, die vom Betrieb analytisch unterscheidbar sind und das Recht haben, über den Verbleib des Eigenkapitals und des mit dessen Hilfe erwirtschafteten Buchprofits (Gewinns) zu entscheiden und sich den Buchprofit ganz oder teilweise auszahlen zu lassen. Ein demokratischer Kooperativbetrieb kann über ein ganz beträchtliches Betriebsvermögen verfügen, aber Eigenkapital in diesem Sinne hat er nicht (andernfalls wäre er nicht demokratisch).
Kreditgeber haben Anspruch auf vorab ausgehandelte Zinsen, aber gerade nicht auf eine „Beteiligung“ am Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens — letzteres haben nur Eigenkapitalgeber. Wo die Kredite herkommen, habe ich in dieser Folge ganz bewusst nicht diskutiert, weil ich mich hier auf die Konsequenz des Punktes „Es gibt keinen Markt für Arbeitskraft als nach dem Gutdünken der Käufer/Mieter einsetzbaren Produktionsfaktor“ (sondern alle Betriebsmitarbeiterinnen sind gleichberechtigt) konzentriert habe.
Ein anderer Punkt, auf den ich noch eingehen werde, sind die Alternativen zu Kapitalmärkten, wo Kreditgeber und Kreditnehmer meistbietend gegeneinander konkurrieren. Selbst wenn es solche Märkte noch geben würde — das war der Punkt in diesem Artikel –, würde sich schon viel ändern, da Fremdkapitalgeberinnen zwar mutmaßlich möglichst hohe Zinsen erwirtschaften wollen, aber anders als Eigenkapitalgeber keinerlei Einfluss auf die Firmenziele nehmen können — und sie konkurrieren ja auch untereinander, d.h. ein Betrieb kann sich die zinsgünstigsten Kreditgeber aussuchen. Ich denke aber, dass in der Gesellschaft, die mir vorschwebt, solche ertragsmaximierenden Kredite tatsächlich die Ausnahme wären. Einige Alternativen hast du schon genannt: Direktkredite durch die versorgte Community, Crowdfunding; es gibt noch weitere. Darauf werde ich demnächst noch eingehen.
Also gut, ich lass mich auf Deine Unterscheidung von Betriebsvermögen und Eigenkapital mal positiv ein, obwohl diese Unterscheidung den meisten gängigen Definitionen des Eigenkapitals widerspricht (https://de.wikipedia.org/wiki/Eigenkapital : Eigenkapital ist gleich Vermögen minus Schulden). In der Realität, dazu werden wir noch kommen, gibt es keine Kredite, wenn nicht nötigungskräftige Sicherheiten diesen gegenüberstehen. Das heißt, Kredit ist zumeist an die Verpfändung von Vermögen geknüpft, das aber in dieser Darstellung am Anfang noch gar nicht existieren kann.
Deine Darstellungsvoraussetzung ist weiterhin, dass – um in Deiner Sprache zu bleiben – Betriebsvermögensbildung über die Tilgung von Schulden im laufenden Geschäftsgang möglich ist. Dieser Illusion bin ich lange angehangen, obwohl mir in den Kapitalschulungen der siebziger Jahre die logische Unmöglichkeit bereits bewiesen wurde. Konkret: Ich habe es als fungierender Kapitalist tatsächlich geschafft (wie das eben ein Kapitalist so schafft: mit reichlichem Einsatz von fremder und eigener Arbeitskraft ), einen Millionenkredit abzuzahlen und ein mit Fremdkapital errichtetes Gebäude ins Betriebsvermögen zu überführen. Nur habe ich leider übersehen, dass die gesamten Annuitäten Abzug von den branchenüblichen Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen waren. Was ich wieder mal lernen durfte war: Die Tilgung von Fremdkapital ist in der gesamten Geschäftswelt eigentlich nicht vorgesehen, wenn Du willst können wir das begrifflich auch an den Bestandtteilen des Profits durchmachen. Aber Donald Duck hat das schon mal für Kinderseelen formuliert, wenn ich mich erinnere heißt der blöde Spruch „Stillstand bedeutet Rückgang“. Die Konkurrenz der Kapitalisten basiert auf der permanenten Inanspruchnahme von Kredit und nicht auf seiner finalen Bedienung.
Zu den Vorstellungen eines freien Kreditmarktes ohne Einfluss der Fremdkapitalgeber auf die Betriebsgebarung hast Du ohnehin schon das notwendige gesagt: Solche Märkte gibt es nicht (mehr). Es ist ja geradezu der Begriff des Finanzkapitals, Kreditvergabe als Mittel aktiver Kontrolle und Dominanz über die „Realwirtschaft“ einzusetzen und diese dem Maßstab maximaler Renditen zu unterwerfen.
Vielleicht bin ich zu spät eingestiegen, denn Du verweist ja auf eine Prämisse dass es nur mehr Co-Betriebe gibt und eigentlich keine Kapitalistinnen im alten Sinn. Dann aber ist für mich die Konkurrenz von Betrieben überhaupt keine sinnvolle Organisationsform mehr.
@Franz Der sog Kredit (eigentlich eher: die Investition) ist in Christians Modell politisch bewirtschaftet (wie auch immer). Aber zu deinem Argument, Franz, das mir auch eingefallen war, kommt ja noch ein zweites: Die Mittel, die durch die „politischen“ Kredite bezahlt werden, müssen ja erst erwirtschaftet werden. Fragt sich nur, von wem, unter welchem Titel? Besteuerung? In jedem Fall geht dieser Teil des „Betriebserfolgs“ (notwendig über die Kosten hinausgehend) sowohl von LM als auch VO ab. Aber immerhin… habens ja dann irgendwie alle so gewollt.
Der Eindruck drängt sich immer wieder auf, dass es „ein bisschen Kapitalismus“ eben nicht gibt. Und man in modernen Zeiten vormoderne Märkte nicht gut simulieren kann. Warum man es dennoch tut, und daran verzweifelt als einer sinnvollen Organisationsform festhält?
Darum: Weil sich auf dem mittlerweile erreichten technologischen Komplexitäts-Niveau der weitere technische Fortschritt und die zugehörigen Optionen von Einzelpersonen überhaupt nicht mehr überblicken lässt (maW von niemand). Wer versucht es denn überhaupt zur Zeit auch nur annähernd? Einzig die verfluchten Finanzjongleure an den Börsen… Und worauf starren sie ununterbrochen, wenn nicht auf (hoffentlich, irgendwie) darstellbare Betriebserfolge, „Fundamentaldaten“, allgemeine und spezielle Nachrichten zu technologischen Innovationen, oder möglicherweise sich öffnenden oder schliessenden Märkten.Die Börsen, die „Finanzmärkte“… das ist unser gegenwärtiges Pendant zur „Zentralen Plankommission“…Demnächst dann ersetzt durch die demarchische Produzenten-Vollversammlung (digital?), die „ihren“ Fortschritt steuern will…
Ich mach bei der Gelegenheit mal Werbung für das Buch von Dario Azzellini über Rückeroberte Betriebe unter Arbeiter*innenkontrolle (RBA) und hab ein paar zentrale Punkte zusammengefasst.
Die Leitfrage lautet: “Ist es möglich im Kapitalismus ‘anders’ zu arbeiten und damit die Perspektive einer demokratischen und solidarischen Gesellschaft jenseits des Kapitalismus aufzuzeigen und zu eröffnen?” (S.7)
Dafür hat Azzellini seit 2004 Feldforschung in dutzenden RBA weltweit betrieben. Es werden Erfahrungen beschrieben aus Frankreich, Italien, Türkei, Griechenland, Ägypten, USA, Ex-Jugoslawien, Argentinien (mit 400 RBA weiterhin die meisten), Brasilien, Uruguay, Venezuela. Es gibt RBA in fast allen Industrien, bisher jedoch nur selten im Dienstleistungssektor.
Im Gegensatz zu den Betriebsbesetzungen der 70er Jahre befindet sich die Arbeiter*innenbewegung seit der Durchsetzung des Neoliberalismus in der Defensive. Die Beteiligten sind weder besonders links noch haben sie Erfahrung in Selbstverwaltung. “Da sind Leute dabei, die früher Berlusconi oder Lega Nord gewählt haben und heute hier sind um eine Fabrik zurückzugewinnen. Wenn du das denen vor sechs Jahren erzählt hättest, hätten die gesagt: ‘Wer? Ich? Bist du irre?’” (Arbeiter aus einem RBA in Milan) Die Besetzung ist eine spontane Reaktion auf eine Verlagerung oder Schließung eines Betriebs, um zu verhindern, dass der Eigentümer die Maschinen abtransportiert. Zunächst beschränken sich die Forderungen oft auf eine Weiterführung des Betriebs durch den Eigentümer oder die Zahlung ausstehender Löhne und Abfindungen. Im Verlauf des Kampfes entwickelt die Belegschaft ein kollektives Bewusstsein und kämpft schließlich für die Übernahme des Betriebs in Arbeiter*innenkontrolle. Dieser politisierende soziale Prozess des Klassenkampfes Arbeit gegen Kapital unterscheidet RBA von traditionellen Genossenschaften, was auch zu anderen Resultaten führt. Genossenschaften hinterfragen selten das Privateigentum an Produktionsmitteln, denn das individuelle Eigentum begründet das Recht auf Partizipation an der Entscheidungsfindung und an der Verteilung der Gewinne. Traditionelle Genossenschaften haben höhere interne Lohnunterschiede; oft Angestellte, die keine Mitglieder sind und werden meist nicht von den Arbeiter*innen selbstverwaltet. Die Genossenschaft neigt dazu sich von anderen Genossenschaften getrennt zu sehen und sich der Marktlogik anzupassen.
Im Prozess der Umwandlung zu einer RBA ändert sich hingegen fast alles. Der Unternehmenszweck der Steigerung des Profits wird durch das Wohlbefinden der Arbeiter*innen ersetzt. Arbeitssicherheit wird zur Priorität, Arbeitsunfälle gehen zurück. Die Produktion wird umgestellt, die Zulieferer und Kunden ändern sich. In allen untersuchten Fällen spielen bei der Produktionsumstellung auch ökologische Kriterien eine Rolle, so wird etwa oft auf Recycling oder biologische Produkte umgestellt. Durch den gemeinsamen Kampf der Arbeiter*innen um ihren Betrieb entwickeln sich neue solidarische soziale Beziehungen und es werden Verbindungen zur Nachbarschaft, zu sozialen Bewegungen und zu anderen RBA geknüpft. Viele RBA stellen Räume für andere soziale und politische Initiativen bereit. Fast alle RBA nehmen die Form der Genossenschaft an, obwohl die rechtlichen Vorgaben nicht zu einer demokratischen Selbstverwaltung passen. Andere rechtliche Formen gibt es nur in Venezuela. Es gibt in RBA keine individuellen Besitzanteile und keine externen Investoren. Alle wesentlichen Entscheidungen trifft die regelmäßige Vollversammlung, es gibt jedoch immer zusätzliche, häufigere Treffen der Abteilungen oder bestimmter Arbeitsgruppen. Kleinere RBA entscheiden tendenziell nach dem Konsensprinzip, in größeren RBA wird häufiger durch große Mehrheiten entschieden. Das bisherige “Regime der Angst” (Vio.Me Arbeiter Makis Anagnostou), die Überwachung durch Vorgesetzte, Kameras und Stechuhren, wird ersetzt durch die Selbstverpflichtung der Arbeiter*innen. Daraus resultiert eine enorme Freisetzung menschlicher Kreativität. In der großen Mehrheit der RBA findet eine gewisse Rotation der Aufgaben statt und das damit erlernte Wissen über die Funktionsweise des Betriebs verbessert die kollektive Entscheidungsfähigkeit. In den RBA verdienen alle Arbeiter*innen das gleiche oder es gibt nur geringe Gehaltsunterschiede. Wie die mittlerweile jahrelange Erfahrung mit hunderten RBA zeigt, gelingt es den meisten RBA ihre egalitäre und demokratische Struktur auch langfristig zu erhalten.
Die größten Probleme sind die rechtliche Unsicherheit und die Schwierigkeit an das nötige Kapital zu kommen. An den RBA zeigt sich, dass kapitalistische Unternehmen sich nicht nur an rein ökonomischen Kriterien orientieren, sondern oft die RBA aus politischen Gründen boykottieren oder gar sabotieren. Ein weiteres Problem ist die mangelnde Unterstützung traditioneller Gewerkschaften. Wenn Gewerkschaften dann mal Anwälte schicken, sind diese sogar eher kontraproduktiv, da sie die Kämpfe auf eine entpolitisierte, rein juristische Ebene verlagern. Ausnahmen sind insbesondere Uruguay und Brasilien sowie teilweise Frankreich wo auch traditionelle Gewerkschaften die RBA unterstützen. Hilfe von politischen Institutionen gibt es nur nachdem entsprechender Druck mittels Protestkampagnen aufgebaut wurde. Bei den meisten RBA erfolgt irgendwann eine Intervention des Staates, sei es die Enteignung der Kapitalist*innen, eine direkte Finanzierung oder Bürgschaften. Wichtig für den Erfolg von RBA ist außerdem wie das Konkursrecht geregelt ist. Trotz der Schwierigkeiten mit denen RBA zu kämpfen haben, weisen sie “eine durchschnittlich längere Lebensdauer als gewöhnliche kapitalistische Privatunternehmen” auf, wie eine Untersuchung in Argentinien gezeigt hat. RBA sind also Realutopien im besten Sinne, sie bieten praktische Lösungen an und sind gleichzeitig der Vorschein auf eine befreite Gesellschaft. Damit RBA dem Kapital wirklich gefährlich werden können wäre m.E. aber eine systematische staatliche Unterstützung notwendig.
“Vor 30 Jahren kam ich als letztes Rad am Wagen hierher – und jetzt diese Fabrik gemeinsam mit anderen selbst zu verwalten, das ist ein Ziel zu erreichen. Das ist das Höchste für einen ausgebeuteten Arbeiter, dass man sagen kann, jetzt beutet mich niemand mehr aus, jetzt ist es meins – endlich fühle ich mich daheim.” (Arbeiter bei einer RBA in Rom, Metallindustrie)
@Benni: Kann ich gerne machen, jo.
An den RBAs wird doch eines ganz deutlich: Leute, die über ihre Arbeit kollektiv verfügen und sie sinnvoll gestalten können, haben keine Konkurrenz-getriebenen VO- oder LM-Interessen, nach dem Motto: Was müssen wir hier (für wen) abliefern, um mit wieviel (für uns) nachhause zu gehen, und DORT leben wir dann; sondern da, wo sie die beste Zeit ihres Lebens verbringen, beim Produzieren, da liegen auf einmal ihre Interessen, und so habe ich immer Marx‘ etwas verunglückte Wendung verstanden: Die Arbeit wird dann erstes Lebensbedürfnis – soll nicht heissen, dass alle workoholics und Stachanows werden, sondern dass sie arbeitend tatsächlich leben, und es nicht nur zweckmässig, sondern befriedigend ist, was sie da tun.
Der innerbetrieblichen Zweckmässigkeit auf befriedigende (und zumindest nicht überfordernde) Weise zu genügen, mag gelingen, sogar auf Dauer. Die Schwierigkeit liegt im Verbund der Betriebe und der Belegschaften – auf Dauer, unter Bedingungen des Lernens und der Notwenigkeit kollektiver Problemlösungen, die hohes Koordinations-Niveau erfordern (hohe Integration der gesamten Reproduktion).
Genau das ist bei ökologischer Produktion der Fall, ich sage obendrein: ebensosehr bei einer Produktion, die darauf hin eingerichtet wird, dass das damit verbrachte Leben für ALLE lebenswert ist; ebenso bei einer, die Verständigung aller mit allen (in allen wesentlichen Hinsichten, als Endzustand, weltweit) zulässt (und in dem Sinn: auf Vergesellschaftbarkeit hin eingerichtet wird).
Kaufen und Verkaufen zwischen Co-Betrieben ist solchen Ansprüchen nicht gewachsen. Aber wenn es das nicht ist – wie will man denn damit den Anforderungen der nächsten 50-100 Jahre genügen?
Was mir zunächst auffällt, ist die Abgrenzung des kooperativen Eigenkapitals zur Neoklassik. Es bekäme dadurch einen anderen Charakter, weil die Genossinnen die Entscheidungen gemeinsam und demokratisch träfen und deshalb keine (besonderen) Ansprüche auf Erträge aus diesem hätten. Hier ist
zunächst festzuhalten, dass es überhaupt keinen Kausalzusammenhang
zwischen der Bedingung (Entscheidungen gemeinsam treffen) und der
Wirkung (keinen Anspruch auf Erträge) gibt. Außerdem hängt die
Bestimmung des Profits (Maximierung oder nur „normal“)
ohnehin nicht von den subjektiven Ansprüchen der Genossinen, ja
nicht einmal von deren Gehaltswünschen, sondern allein von der
Konkurrenz ab, sodass, wenn ein Unternehmen nicht ausscheiden will
und die Mitarbeiterinnen ihre Existenzgrundlage verlieren wollen,
auch solche kooperativ geführten Unternehmen ihre Produktion so
ausrichten müssen, dass die Grenzkosten mit den Marktpreisen
übereinstimmen. Das ist eben die ganz normale Folge, wenn frau
Unternehmen und Menschen in einem Reproduktionssystem gegeneinander
antreten lassen will und unabhängig von deren direkten Willen und
Bedürfnis meint, dass quasi gem. der unsichtbaren Hand sich schon
irgendwie die bestmögliche Bedürfnispräferenzen einstellen und
bedient würden. Aber da, denke ich, sind Schumpeter und Downs schon
weiter gewesen, die gem. ihrem rationalistischen Ansatz die Seele
des Menschen in der Marktwirtschaft analysiert und als die eines
Konkurrenzkrüppels bzw. Nutzenmaximieres bestimmt hatten. Weshalb
gilt: „Kaufen und Verkaufen zwischen Co-Betrieben“ ist „einer Produktion, die darauf hin eingerichtet wird, dass das damit verbrachte Leben für
ALLE lebenswert ist“ nicht gewachsen. (franziska)
Was ich nicht verstehe, ist, dass ausgehend von der Notwendigkeit des Geldes und der Unmöglichkeit rationaler Planung von Christian eine Konkurrenzökonomie ohne Kapitalisten vorgestellt wird, die dann irgendwie doch alle schädlichen Wirkungen der Konkurrenz hinter sich lassen soll (kein Markt für Arbeitskraft), einen Fonds für Grundeinkommen speisen und die Gesellschaft mit allen notwendigen Gütern und Dienstleistungen versorgen soll.
Das ist ein ziemlich unwahrscheinliches und inkonsistentes Konstrukt, um es höflich zu sagen, und ich sehe auch keine gesellschaftliche Kraft die sich für so etwas stark macht, abgesehen davon dass irgendeine Form von universeller Expropriation in diesem Konstrukt stattgefunden haben MUSS. Das ist nur als Werk einer Revolution oder staatlicher Gewalt gegen KapitalistInnen denkbar. Die Vorstellung, die Massen dafür zu gewinnen, dass sie weiter in einem gezähmten Geldsystem leben, und so nach links zu treiben und das Konstrukt zu realisieren, scheint mir eher ein Wunschtraum von jemandem, der wie die gesamte traditionelle Linke auf die Kritik der Massen verzichten möchte. WENN wir die Planwirtschaft und die Gebrauchswertorierung aufgeben, DANN haben wir vielleicht ein Leiberl.
Wobei die „Kritik der Massen“ und das praktische experimentelle Ausprobieren neuer Vergesellschaftungsformen jenseits von Geld und Konkurrenz keine Gegensätze mehr sein dürften. Es sind nur einander ergänzende Modi.
Was ich an Keimform zunehmend vermisse ist das Aufspüren und Analysieren von tatsächlich existierenden Keimformen einer anderen Vergesellschaftung, insoferne wirkt manus Beitrag (#8) hier wie eine Erinnerung an diese Richtung. Und ja allerdings, mir ist nicht bekannt dass es von Seiten besetzter Betriebe jemals eine umfassende Idee für eine Verkettung betrieblicher Logiken zu einem „System der Arbeiten und Bedürfnisse“ gegeben hätte.
Um noch mal auf das Eigenkapital zu kommen.
Christian verwendet zur Bestimmung zunächst die einleitende tautologische Definition von Gablers Wirtschaftslexikon: Eigenkapital ist kein Fremdkapital. Dann bezieht er sich auf den rechtlichen Abgrenzungs-Standpunkt, dass Eigenkapital Eigentum einer oder mehrerer juristischer Personen sei und leitet daraus das Merkmal ab, dass diese analytisch vom Betrieb unterscheidbar wären. Also wohl so zu verstehen, dass deren Interesse weniger auf einen gut organisierten und funktionierenden Betrieb, sondern vorrangig auf den Ertrag aus dem eingesetzten Kapital gerichtet ist. Diese Bestimmung ist nicht plausibel. Selbst wenn die Eigentümer nur am direkten Betriebsgeschehen unbeteiligte Anteilseigner sind, haben sie im allgemeinen ein Interesse an einem gut geregelten und funktionellem Verlauf des Betriebes. Dafür nämlich setzen sie ein hoch bezahltes Management ein. Als zweites Abgrenzungsmerkmal führt er an, dass die Eigentümer das Recht haben, über den Verbleib des Kapitals sowie die Verwendung des Profits zu bestimmen. Das allerdings ist kein Unterscheidungsmerkmal zum „Betriebsvermögen“ der
Kooperative, weil diese als juristische Person ja auch Eigentümer ist und über diese Rechte verfügt. Er führt nun ein weiteres, methodisches, Kriterium ein: das demokratische Verfahren. Mit diesem bedründet er schon in seinem Artikel tautologisch, wenn dieses vorläge kann es kein Eigenkapital geben, da ja keine Ansprüche auf dieses bestünden, wo wir schon erfahren haben, dass Eigenkapital derart definiert ist. Schließlich kommt er bei der Abgrenzung zum
Eigenkapital zu dem tautologischen Schluss: „Ein demokratischer Kooperativbetrieb kann über ein ganz beträchtliches Betriebsvermögen verfügen, aber Eigenkapital in diesem Sinne hat er nicht.“ obwohl er zuvor „Betriebsvermögen“ in diesem Sinne schon vom Eigenkapital abgegrenzt hatte.
Damit wird vielleicht deutlich, dass sich Eigenkapital nicht aus subjektiven Interessen oder politischen Ansprüchen, sondern nur anhand seiner ökonomischen Zweckbestimmung erklären lässt. Was auch heißen soll, dass sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen gegeneinander konkurrierende
Kooperativen den negativen Folgen, welche das Eigenkapital bedingt, nicht entziehen können.
@Franz:
Stimmt. Aber hier geht es um eine Gesellschaft, wo es zwar Geld und Preise und Betriebe gibt, aber keine Kapitalisten. Das ändert sehr viel.
An Betrieben als eigenständig handlungsfähigen Einheiten führt, soweit ich das sehe, kein Weg vorbei (sofern man nicht auf Zentralplanung oder komplett isolierte Eigenarbeit ohne gesellschaftliche Kooperation oder romantische Vorstellungen einer reinen Schenkökonomie hoffen will). Konkurrenz muss es deshalb nicht geben, das ist richtig. Demnächst mehr.
Das gilt allerdings auch für jegliche andere Idee nichtkapitalistischen Wirtschaftens. Solange eine kleine privilegierte Minderheit von Kapitalisten oder Vermögenden 99 Prozent aller Ressourcen kontrolliert, werden nichtkapitalistische Produktionsweisen sich sonst höchstens in Nischen entfalten können.
@manu: Danke für den Hinweis auf das Buch von Dario Azzellini, klingt sehr spannend!
@ricardo:
Genau, deshalb nenne ich ja auch lohnmaximierende Betriebe als eine Möglichkeit. Der Unterschied ist allerdings auch da, dass eben nicht die eine mehr kriegt (weil sie mehr Eigenkapital eingebracht hat), die andere weniger (weil sie wenig eingebracht hat), da keine der Stimmberechtigten Kapital/Geld eingebracht hat und Stimmrecht nicht an Kapitaleigentum gebunden ist.
Wenn aber alle Entscheidungsberechtigten Mitarbeiter_innen sind und alle Mitarbeiter_innen entscheidungsberechtigt, wenn zudem das Prinzip gilt: eine Person = eine Stimme und nicht (wie bei Aktiengesellschaften) ein Anteil = eine Stimme, dann handelt es sich mit Sicherheit um keinen kapitalistischen Betrieb.
Hmm hmm .. ehrlich gesagt halte ich das ganze weiter für Humbug solange du, Christian, dich nicht mit Konkurrenz auseinandersetzt. Aber das sagst du ja willst du als nächstes machen. Klar Kollektivbetriebe sind sicher besser für die Arbeiter*innen aber wenn sie weiter in Konkurrenz stehen müssen sie den gleichen Scheiß nur abgeschwächt machen … Aber viel Glück beim weiter denken … Insgesamt fehlt mir in dem ganzen oberen Text auf jeden Fall die Betonung dass Profit nicht nur an Fremd- oder Eigenanteileigner*innen, oder Arbeiter*innen, oder als Rücklage für schlechte Zeiten gilt, sondern v.a. reinvestiert werden muss um die Kosten zu senken, Marktanteile zu erhöhen, die Produktion effizienter zu gestalten, etc.
@Stefan.
Christians Definitionen und Ausführungen gemäß verliert ein Kooperativbetrieb durchaus (bzw. zumindest zu einem gehörigen Teil) seinen kapitalistischen Charakter, da sein (vorrangiges) Produktionsziel nicht mehr die Kapitalverwertung ist.
@Simon, du schreibst: „Insgesamt fehlt mir in dem ganzen oberen Text auf jeden Fall die Betonung dass Profit nicht nur an Fremd- oder Eigenanteileigner*innen, oder Arbeiter*innen, oder als Rücklage für schlechte Zeiten gilt, sondern v.a. reinvestiert werden muss um die Kosten zu senken, Marktanteile zu erhöhen, die Produktion effizienter zu gestalten, etc.“
Ich gehe davon aus, dass Christian in seinem nächsten Text „wirtschaftliche Rahmenbedingungen“ beschreiben wird welche aufzeigen sollen, dass es trotz Märkte und Geld nichtzwangsläufig zu Reinvestition zwecks Kostensenkung und Marktexpansion kommen muss. Ob dies so ist und wie sich dies denken ließe, muss im kommenden Artikel diskutiert werden.
@Franz, du behauptest es gäbe „auch keine gesellschaftliche Kraft die sich für so etwas stark macht“. Das stimmt so nicht. Siehe beispielsweise das auf David Schweickarts Modell basierende „The Next System Project“, dessen Ideen im Zuge des isländischen Verfassungsreferendums zumindest in die Debatte einflossen (auch wenn es wenig Interessenten gab). Damit dürften derlei Vorstellungen mit denen des „Commonismus“ in der Popularität gleichauf oder sogar bekannter sein.
Weiterhin schreibst du: „mir ist nicht bekannt dass es von Seiten besetzter Betriebe jemals eine umfassende Idee für eine Verkettung betrieblicher Logiken zu einem „System der Arbeiten und Bedürfnisse“ gegeben hätte.“
In dieser Absolutheit stimmt dies ebenfalls nicht. Es ließen sich Ansätze während der Spanischen Revolution von 1936 nennen. In der heutigen Zeit versucht die aus dem Umfeld der Freien Arbeiter/innen Gewerkschaft stammende Union Coop kooperativere zwischenbetriebliche Koordinationen herzustellen.
Dass all diese Initiativen ohne entsprechende Gestaltungsmacht nicht hegemonial werden können sollte auf der Hand liegen.
„Christians Definitionen und Ausführungen gemäß verliert ein ooperativbetrieb durchaus (bzw. zumindest zu einem gehörigen Teil) seinen kapitalistischen Charakter, da sein (vorrangiges) Produktionsziel nicht mehr die Kapitalverwertung ist.“
Das ist aber nicht explizit ausgeführt. Wenn ich Christian richtig verstanden habe, dann verlöre ein Kooperativbetrieb seinen kapitalistischen Charakter dann, wenn die zu Eigentümern gewordenen Mitarbeiter nun nicht mehr den ökonomischen Bezug der Profitmaximierung zum Eigenkapital hätten sondern den politischen Bezug der demokratischen Entscheidung. Allerdings durch die Veränderung des Bezug zu einem Gegenstand ändert dieser nicht seinen Charakter. Das zum einen.
Christian, so verstehe ich ihn, geht davon aus, dass wenn sich der Bezug ändert, per se auch der Zweck bzw. die Zielsetzung ändert, also die Profitmaximierung zur Lohnmaximierung wird, damit der kapitalistische Zweck des EK wegfiele und sich damit quasi auflösen würde. Er setzt hier also an der rational-choice theorie der Nutzenmaximierung an und sagt, wenn sich die am Nutzen orientierenden Subjekte ändern, dann ändern sich auch die Präferenzen der Subjekte: es fände also ein Wechsel per se von der Profitmaximierung zur Lohnmaximierung statt. Und da gibt es eben zwei Kritikpunkte: einen generellen, ob das Nutzenmaximierungsprinzip überhaupt etwas für die Erklärung der Wirklichkeit taugt und dann den von Stefan, Simon, Franz u. a. vorgebrachten Einwand, ob sich die durch subjektive Entscheidung getroffene Zielsetzung, das Eigenkapital nicht mehr zu verwerten, in der marktwirtschaftlichen Realität überhaupt durchsetzen lässt – falls nicht: dann hätte sich aber an der ökonomischen Zwecksetzung und Bestimmung des EK nichts geändert, sondern nur die Form des rechtlichen Eigentums an diesem.