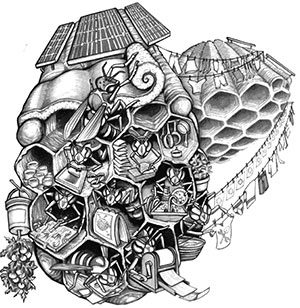Man freut sich ja immer über gute Kritik, und eine hat die Redaktion des Teichoskopie geschrieben. Sie treten für Räte vs. Commonismus ein. Hier der ganze Text. Und hier ein Ausschnitt: „Die positive Bestimmung eines Common wäre hingegen, dass die Individuen an der Verfügung über es teilhaben, nicht über es als eine einzelne Sache, aber über das Gesamtprodukt, dessen Teil jedes Common ist, wenn das Common die Elementarform des Commonismus ist. Über die Verwendung der Commons entscheidet also die Gesamtheit der
Individuen, richtiger noch: die Allgemeinheit. Dazu bedarf es einer sie zusammenfassenden Verwaltungsstruktur. Dass die sich einfach so aus dem Netz von Commons „emergent“ ergebe, wie die Autoren behaupten, klingt wie der Glaube an die „invisible hand“ von Smith. Und nur ihre Gleichsetzung von Zentralismus und Dirigismus verleitet sie offenbar zu diesem Glauben. Aber eine gewisse Zentralisierung ist notwendig, und das bedeutet nicht automatisch, dass die Koodinationsstellen oder -commons Befehlsgewalt haben.“
(mehr …)